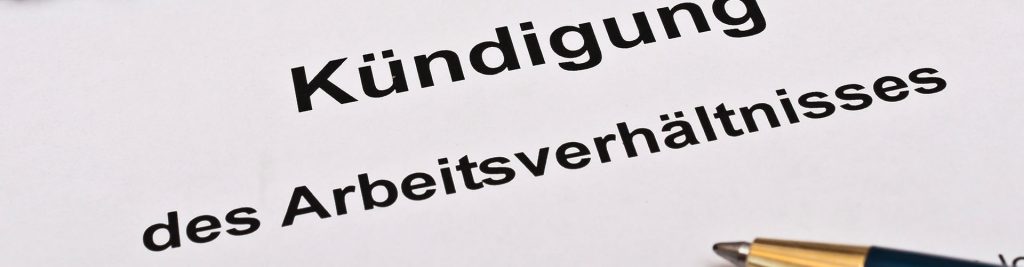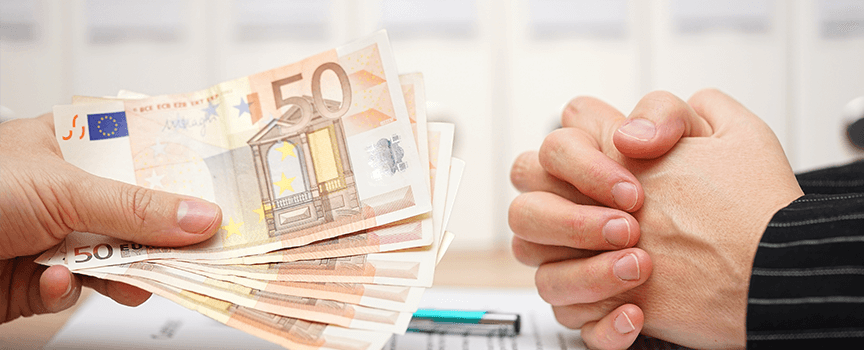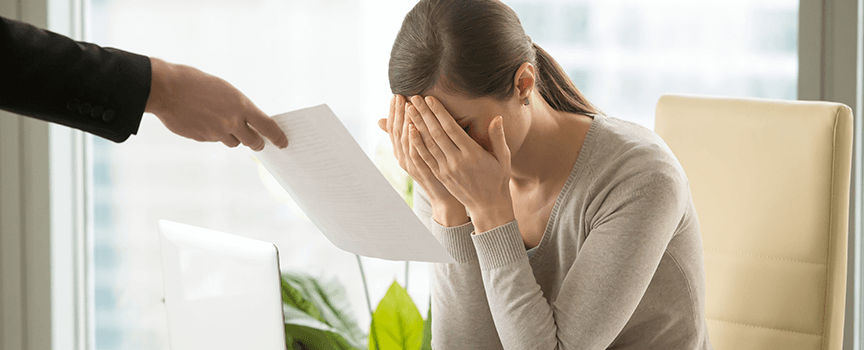1. Dienstwagenüberlassung – Rechtsnatur je nach Arbeitsvertrag
Es sind zwei Konstellationen zu unterscheiden, die beide Gegenstand des Arbeitsvertrags sein können:
Dienstwagen wird ausschließlich zur beruflichen Nutzung überlassen
Dient das Fahrzeug ausschließlich dienstlichen Zwecken, ohne dass im Arbeitsvertrag eine private Nutzung gestattet ist, handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein reines Arbeitsmittel.
Das Nachkommen dienstlicher Zwecke ist im weitesten Sinne die Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten (z.B. Wahrnehmung von Außenterminen). Wenn der Dienstwagen nur diesem Arbeitsziel dienen soll, kann der Arbeitgeber das Fahrzeug jederzeit zurückfordern, da es nicht Teil der Vergütung ist. Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf eine Nutzung außerhalb des Dienstverhältnisses, muss umgekehrt aber auch nicht befürchten, dass die Fahrten bezogen auf sein Gehalt in Abzug gebracht werden.
Dienstwagen mit zusätzlicher privater Nutzungsoption
Wird dem Arbeitnehmer dagegen die private Nutzung des Dienstwagens von seinem Arbeitgeber vertraglich gestattet, erhält er damit einen geldwerten Vorteil. Kurz gesagt: Diese Privatnutzung des Wagens wird behandelt wie ein Gehaltsbestandteil. Die Überlassung des Dienstwagens mit privater Nutzung ist daher rechtlich als Sachbezug zu werten.
2. (Fristlose) Kündigung und Zeitpunkt der Rückgabe des Dienstwagens
Ordentliche Kündigung – Nutzung bis zum letzten Arbeitstag
Bei einer ordentlichen Kündigung – egal ob durch den Arbeitnehmer oder durch den Arbeitgeber – endet das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf der Kündigungsfrist (§ 622 BGB).
Etwas anderes gilt nur, wenn im Arbeitsvertrag selbst, in einer separaten Dienstwagenüberlassungsvereinbarung oder in einer Betriebsvereinbarung ausdrücklich vereinbart wird, dass der Dienstwagen bereits früher (z. B. während einer Freistellung) zurückzugeben ist. Fehlt eine solche Regelung, darf der Arbeitnehmer den Wagen bis zum letzten Arbeitstag nutzen.
Fristlose Kündigung – sofortige Rückgabe
Wenn dem Arbeitnehmer fristlos gekündigt wird, endet das Arbeitsverhältnis sofort, d.h. mit dem Zugang der Kündigungserklärung. Damit endet grundsätzlich auch das Nutzungsrecht am Dienstwagen und der Arbeitgeber darf dessen sofortige Herausgabe verlangen, auch wenn später über die Wirksamkeit der Kündigung gestritten wird (Kündigungsschutzklage).
3. Freistellung des Arbeitnehmers und Widerruf der Dienstwagennutzung
Das Weisungsrechts des Arbeitgebers (§ 106 GewO) stößt an seine Grenzen, wenn es darum geht, dem Arbeitnehmer einseitig Vergütungsbestandteile zu entziehen. Dafür bedarf es vielmehr der Ausübung einer wirksamen Widerrufsklausel im Arbeitsvertrag. Ohne eine solche Klausel darf der Arbeitgeber nicht einfach das Dienstfahrzeug zurückfordern.
Der Arbeitgeber muss eine zum Widerruf der Dienstwagennutzung berechtigende Klausel so transparent abfassen, dass die Gründe für einen künftig möglichen Widerruf benannt werden.
Widerrufsgründe können dabei sein:
- wirtschaftliche Gründe (Liquiditätsengpass im Betrieb)
- Änderung der Aufgaben des Arbeitnehmers (keine Verrichtung mehr im Außendienst)
- Freistellung oder (fristlose) Kündigung des Arbeitnehmers
- Gründe in der Person des Arbeitnehmers (z. B. Krankheit, bzw. körperliche Einschränkung des Arbeitnehmers, die ein sicheres Fahrzeug steuern unmöglich macht oder Führerscheinentzug)
Neben dem Widerrufsgrund müssen die Widerrufsklauseln:
- klar und verständlich formuliert sein
- konkrete Widerrufsgründe enthalten (s.o.)
- die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Arbeitnehmer kalkulierbar machen
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist ein untermonatiger Entzug regelmäßig unbillig, wenn keine besonderen Umstände vorliegen. Andernfalls kann der Arbeitnehmer eine Entschädigung verlangen (vgl. BAG, Urteil vom 12.02.2025 – Az. 5 AZR 171/24).
Bei dem Entschädigungsposten handelt es sich um einen „Steuerverlust ohne Fahrzeugnutzung“. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG kann nämlich der zu versteuernde geldwerte Vorteil nur monatlich und nicht kalendertäglich angesetzt werden. Das führt dazu, dass der Arbeitnehmer bei einer Rückgabe des Dienstwagens mitten im laufenden Monat die Steuerlast für den ganzen Monat trägt, also auch für die Zeit, in der er den Pkw nicht mehr nutzen kann. Da es sich bei diesem Verlust nicht um Arbeitsleistung handelt, kann der Arbeitnehmer diesen Schaden als Entschädigung geltend machen.
4. Rückgabe des Dienstwagens im Aufhebungsvertrag
Neben einem Widerrufsvorbehalt im laufenden Arbeitsvertrag kann ein separater Aufhebungsvertrag die Rückgabe des Dienstwagens ebenfalls regeln. Im Unterschied zum Widerrufsvorbehalt, bei welchem der Arbeitgeber einseitig die private Nutzung des Dienstwagens widerrufen kann (wenn die vertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind), wird beim Aufhebungsvertrag nachträglich und beidseitig die Rückgabe vereinbart.
Im Aufhebungsvertrag sollten folgende Fragen zur Nutzung und Rückgabe des Dienstwagens explizit geregelt werden:
- Rückgabedatum,
- Rückgabeort,
- Kostentragung (z. B. für verbleibende Leasingraten),
- Möglichkeit zur dauerhaften Übernahme des Wagens gegen Kaufpreis (Eigentumsübertragung),
- Rückgabezustand, Versicherung und evtl. Schäden
5. Fazit
- Darf ein Dienstwagen ausschließlich zu dienstlichen Zwecken genutzt werden, handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein reines Arbeitsmittel. Hingegen wird die arbeitsvertraglich eingeräumte Privatnutzung wie ein Gehaltsbestandteil behandelt.
- Bei der ordentlichen Kündigung besteht das Nutzungsrecht am Dienstwagen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fort, außer es besteht eine anderslautende Vereinbarung. Wenn dem Arbeitnehmer dagegen fristlos gekündigt wird, darf der Arbeitgeber die sofortige Herausgabe des Dienstwagens verlangen, sofern die Kündigung nicht offensichtlich unwirksam ist.
- Ein einseitiger Entzug des Dienstwagens durch den Arbeitgeber im laufenden Arbeitsverhältnis (z. B. bei Freistellung des Arbeitnehmers) ist nur bei einer wirksamen Widerrufsklausel im Arbeitsvertrag möglich.
- Ein Aufhebungsvertrag kann die Rückgabe des Dienstwagens ebenfalls regeln, wobei auch hier auf eine detaillierte Erfassung der Rückgabebedingungen zu achten ist.