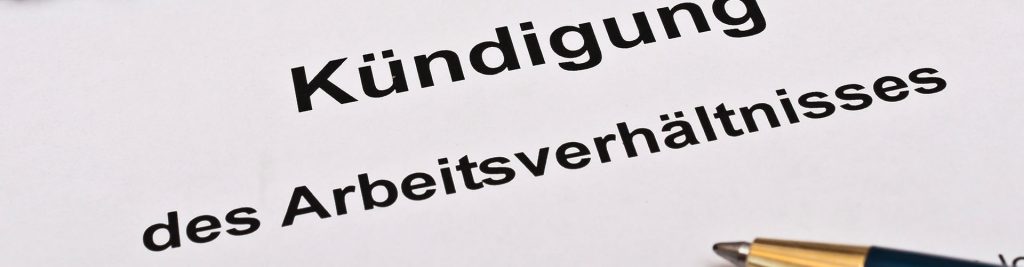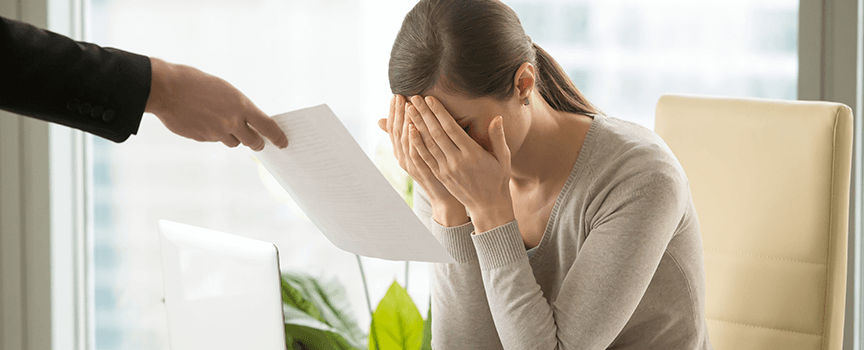- Was ist eine Kündigungsschutzklage?
- Wann greift das Kündigungsschutzgesetz?
- Welche Frist gilt für die Kündigungsschutzklage? Was passiert, wenn sie verstrichen ist?
- Wie läuft ein Kündigungsschutzverfahren vor dem Arbeitsgericht ab?
- Wie hoch sind die Kosten einer Kündigungsschutzklage?
- Ist eine Abfindung realistisch?
- Fazit
1. Was ist eine Kündigungsschutzklage?
Eine Kündigungsschutzklage (umgangssprachlich auch „Arbeitsschutzklage“) sichert dem Arbeitnehmer im Falle des Obsiegens seine Beschäftigung bei seinem Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer erreicht damit den Erhalt des Status quo, d.h. er muss weiter seine Arbeitsleistung erbringen und sein Arbeitgeber entsprechend den Lohn fortzahlen unter den vor der Kündigung vereinbarten Arbeitsbedingungen.
Bereits die Androhung einer Kündigungsschutzklage verschafft dem Arbeitnehmer regelmäßig eine günstige Verhandlungsposition für eine hohe Abfindung. Das ist zumindest der Fall, wenn der Arbeitgeber ernsthaft befürchtet, dass er den Prozess verliert.
Neben ordentlichen Kündigungen können auch außerordentliche (fristlose) Kündigungen auf ihre Wirksamkeit hin gerichtlich überprüft werden.
Typische Gründe für die Unwirksamkeit einer Kündigung sind beispielsweise:
- Formfehler (nicht schriftlich, fehlende Unterschrift, falsche Vollmacht)
- Sozialwidrigkeit (keine ausreichende Sozialauswahl)
- Verstoß gegen Sonderkündigungsschutz (z. B. bei Schwangeren, Schwerbehinderten, Betriebsratsmitgliedern)
- fehlende Zustimmung einer Behörde, z. B. Integrationsamt oder Mutterschutzbehörde oder
- willkürliche bzw. diskriminierende Gründe (z. B. Kündigung wegen Geschlecht, Herkunft oder Religion)
2. Wann greift das Kündigungsschutzgesetz?
Das KSchG ist der Türöffner für die Kündigungsschutzklage und findet Anwendung, wenn:
- der Arbeitnehmer länger als sechs Monate ohne Unterbrechung im Betrieb beschäftigt ist (§ 1 Abs. 1 KSchG),
UND
- der Arbeitgeber regelmäßig mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt (§ 23 KSchG). In Kleinbetrieben mit zehn oder weniger Mitarbeitern gilt das KSchG also nicht. Dabei werden Arbeitnehmer durch ihre wöchentlichen Arbeitsstunden „berechnet“ und wie folgt gezählt:
- Vollzeit = 1 Mitarbeiter
- Teilzeit (mehr als 30h/Woche – 40h/Woche) = 1 Mitarbeiter
- Teilzeit (mehr als 20h/Woche – 30h/Woche) = 0,75 Mitarbeiter
- Teilzeit (bis zu 20h/Woche) = 0,5 Mitarbeiter
- Auszubildende, Praktikanten und Geschäftsführer = 0 (sie zählen nicht als Mitarbeiter)
Im Falle einer Kündigungsschutzklage tragen Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast dafür, ob das Kündigungsschutzgesetz anzuwenden ist.
Im Kleinbetrieb kann der Arbeitgeber zwar auch ohne Angabe eines „sozial gerechtfertigten Grundes“ i.S.d. § 4 KSchG kündigen, aber: Sobald die Kündigung willkürlich, diskriminierend, treuwidrig oder sittenwidrig ist, kann sie (ebenfalls innerhalb von drei Wochen) vor Gericht angegriffen und für unwirksam erklärt werden. Die Unwirksamkeitsgründe für diese Fälle sind im Gesetz verstreut geregelt und u.a. in § 138 BGB (Sittenwidrigkeit) und § 242 BGB (Treu und Glauben) verankert. Das Maßregelungsverbot ist in § 612a BGB normiert. Aus Art. 3 GG sowie dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) folgt der Diskriminierungsschutz bei Kündigungen.
3. Welche Frist gilt für die Kündigungsschutzklage? Was passiert, wenn sie verstrichen ist?
Zwei Ausnahmen von dieser Frist sind von Bedeutung:
- Die Kündigung wurde nicht schriftlich erklärt: Das vom Arbeitgeber unterzeichnete Kündigungsschreiben muss dem Arbeitnehmer im Original zugehen. Die Übersendung einer Kopie reicht nicht aus. Aus diesem Grund kann der Arbeitgeber eine Kündigung auch nicht wirksam mündlich, per E-Mail oder per WhatsApp-Nachricht übermitteln.Verstöße gegen das Schriftformerfordernis von § 4 S. 1 KSchG („Zugang der schriftlichen Kündigung“) führen zur Nichtigkeit der Kündigung, es wird also keine 3-Wochen-Frist in Gang gesetzt.
In der Praxis sollte der Arbeitnehmer trotzdem fristgerecht Kündigungsschutzklage einreichen und die Kündigung so behandeln, als wäre sie schriftlich ergangen. Denn nur nach einer fristgerechten Klage kann und wird das Gericht eindeutig die Unwirksamkeit der Kündigung feststellen.
- Die Kündigung bedurfte einer behördlichen Zustimmung, die ausblieb: Dann verlangt 4 S.4 KSchG, dass die Klagefrist erst ab Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an den Arbeitnehmer läuft. So ist beispielsweise die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen nur mit Zustimmung des Integrationsamtes zulässig.
4. Wie läuft ein Kündigungsschutzverfahren vor dem Arbeitsgericht ab?
Einreichung der Klage beim örtlich zuständigen Arbeitsgericht
Der Arbeitnehmer (oder sein Rechtsanwalt) muss zunächst die Kündigungsschutzklage schriftlich oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichts einreichen. Mindestinhalt der Klage sind Kündigungsgründe (wenn angegeben) sowie der Kündigungszeitpunkt. Der Klageantrag muss außerdem die Feststellung enthalten, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die Kündigung des Arbeitgebers nicht aufgelöst wurde.
Gütetermin
Nach Eingang der Klage setzt das Gericht zeitnah einen Gütetermin an mit dem Ziel einer einvernehmlichen Beilegung des Rechtsstreits. Viele Verfahren enden hier mit einem gerichtlichen Vergleich, z. B. unter Zahlung einer Abfindung, da die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses oft Unannehmlichkeiten birgt, nachdem sich die Arbeitsvertragsparteien in einem Gerichtssaal gegenübergestanden haben.
Kammertermin
Führte der erste (und ggf. ein weiterer) Gütetermin zu keinem Konsens innerhalb des Kündigungsstreits, folgt ein Kammertermin. Dort wird, nachdem beide Parteien schriftlich zur Klage Stellung bezogen haben, eine Beweisaufnahme vollzogen u.a. durch Hinzuziehung von Zeugen und Urkunden. An der Verhandlung nehmen neben dem Vorsitzenden (Berufsrichter) zwei ehrenamtliche Richter (je einer auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite) teil.
Am Ende der Verhandlung steht entweder ein Vergleich oder ein Urteil, mit dem das Gericht über die Wirksamkeit der Kündigung und somit den Fortbestand bzw. das Ende des Arbeitsverhältnisses entscheidet. Innerhalb eines Monats ab Urteilsverkündung kann gegen die Entscheidung Berufung beim Landesarbeitsgericht eingelegt werden.
Erst ab dieser zweiten Instanz besteht Anwaltszwang.
5. Wie hoch sind die Kosten einer Kündigungsschutzklage?
Die Kosten der Arbeitsschutzklage setzen sich zusammen aus Gerichts- und Anwaltskosten und richten sich nach dem sogenannten Streitwert, der bei Kündigungen regelmäßig drei Bruttomonatsgehältern entspricht (§ 42 GKG analog).
Die Gerichtskosten sind zu zahlen, wenn es zu keinem Vergleich kommt. Die Anwaltskosten trägt im erstinstanzlichen arbeitsgerichtlichen Verfahren jede Partei unabhängig vom Verfahrensausgang (§ 12a Abs. 1 S. 1 ArbGG).
Rechenbeispiel beim Kündigungsschutzverfahren:
- Der Arbeitnehmer verdient 3.000 € brutto/Monat.
- Der Streitwert beträgt drei Bruttomonatsgehälter (3 x 3.000 € = 9.000 €)
- Bei einer Kündigungsschutzklage liegen die Gerichtskosten bei 521 €. Diese sind vollständig von der Partei zu zahlen, die den Prozess verliert.
Das gilt jedoch nur, wenn ein Urteil den Prozess beendet. Endet das Verfahren dagegen durch einen Vergleich, entfallen die Gerichtskosten im ersten Rechtszug vor dem Arbeitsgericht (§ 12a ArbGG) regelmäßig vollständig. - Die Anwaltskosten belaufen sich auf 1.481,25 €, sollte ein Urteil ergangen sein. Bei einem geschlossenen Vergleich betragen sie für jede Partei 2.073,75 €.
- Hinzu kommt außerdem stets eine Auslagenpauschale von max. 20 € sowie 19 % Umsatzsteuer.
| Kostenart | Urteil | Vergleich |
| Gerichtskosten | 521 € | i.d.R. 0,00 € |
| Anwaltskosten | 1.481,25 € | 2.073,75 € |
| Auslagenpauschale | + 20,00 € | + 20,00 € |
| Umsatzsteuer | + 285,24 € | + 397,81 € |
| Gesamtkosten pro Partei | 2.406,49 € | 2.491,56 € |
Prozesskostenhilfe
Wer wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die Kosten der Kündigungsschutzklage zu tragen, kann Prozesskostenhilfe (PKH) beantragen nach § 114 ZPO.
Voraussetzungen für die Bewilligung der Prozesskostenhilfe sind:
- Bedürftigkeit (kein oder nur geringes Einkommen/Vermögen),
- die Klage hat hinreichende Erfolgsaussicht,
- die Klage ist nicht mutwillig.
Da die Wirksamkeit einer Kündigung fast immer streitig ist, wird PKH häufig bewilligt und der Staat übernimmt ganz oder teilweise die Gerichtskosten und Anwaltsgebühren. Bei Gewerkschaftsmitgliedern trägt oftmals die Gewerkschaft die Kosten der anwaltlichen Vertretung.
6. Ist eine Abfindung realistisch?
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung einer Abfindung gibt es im deutschen Arbeitsrecht grundsätzlich nicht. Dennoch wird in der Praxis häufig eine Abfindung im Rahmen eines Vergleichs vereinbart, vor allem, wenn die Wirksamkeit der Kündigung unklar ist.
Die Höhe der Abfindung ist Verhandlungssache. Eine gängige Formel lautet: 0,5 Monatsgehälter × Beschäftigungsjahre
Rechenbeispiel: Monatsgehalt: 3.000 € brutto, Beschäftigungsdauer: 8 Jahre
0,5 × 3.000 € × 8 Jahre = 12.000 € brutto Abfindung
Mit unserem Abfindungsrechner können Sie die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage bestimmen und die Höhe Ihrer voraussichtlichen Abfindung ermitteln:
7. Fazit
- Eine Kündigungsschutzklage ist eine Klage auf Feststellung, dass die Kündigung durch den Arbeitgeber unwirksam ist und das Arbeitsverhältnis fortbesteht.
- Typische Unwirksamkeitsgründe für eine arbeitgeberseitige Kündigung sind Formfehler, keine ausreichende Sozialauswahl oder ein Verstoß gegen Sonderkündigungsschutz (z. B. bei Schwangeren oder Schwerbehinderten)
- Eine Klage ist möglich, wenn der Arbeitnehmer länger als sechs Monate im Betrieb beschäftigt ist und dieser regelmäßig mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter hat.
- Eine Kündigungsschutzklage ist allerdings auch im Kleinbetrieb statthaft, jedoch nur bei Verletzung grundlegender Schutzrechte durch den Arbeitgeber.
- Die Verfahrenskosten richten sich nach dem sogenannten Streitwert, der bei Kündigungen in der Regel drei Bruttomonatsgehältern entspricht.